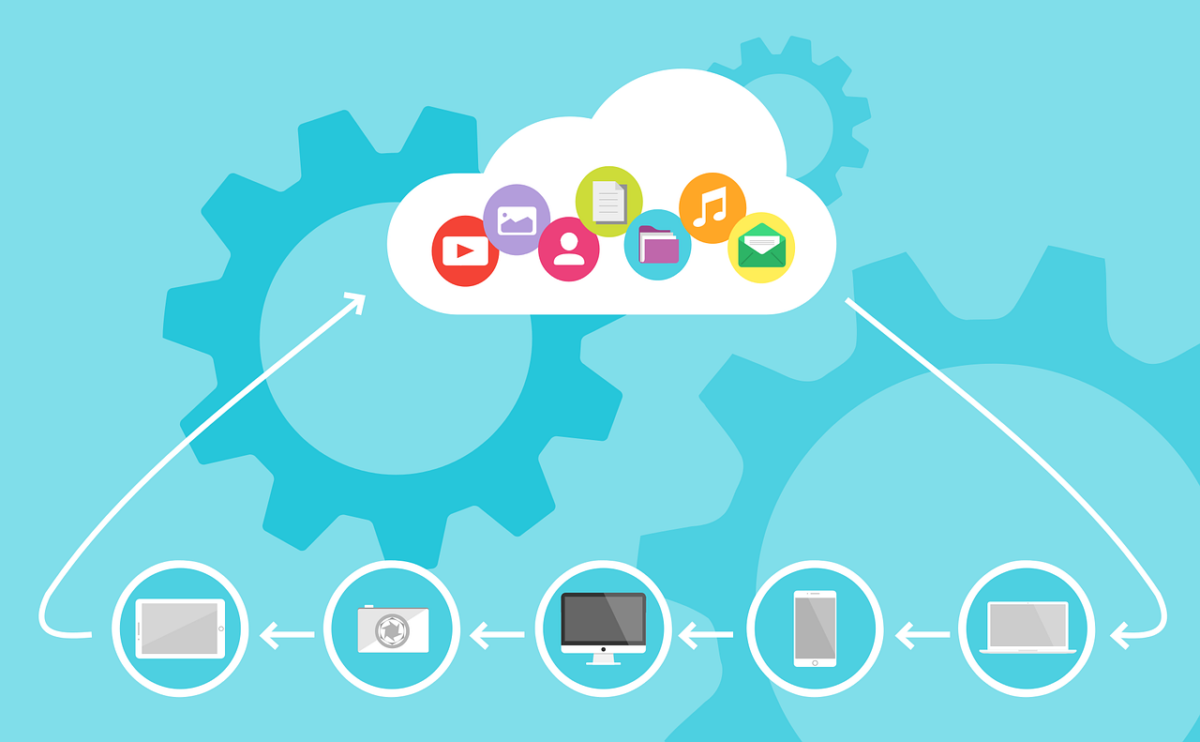Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran und mit ihr neue gesetzliche Rahmenbedingungen. Eine der wichtigsten Neuerungen für Unternehmen, die digitale oder digitalisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten, ist der EU Data Act. Dieses Gesetz bringt überwiegend schon ab dem 12. September 2025 signifikante Änderungen mit sich, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu und die Nutzung von Daten, die durch Produkte generiert werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Unterscheidung zwischen “vernetzten Produkten” und “verbundenen Diensten“. Warum ist das wichtig? Weil daraus konkrete Pflichten für Ihr Unternehmen entstehen können – hervorzuheben ist die Pflicht zur Datenbereitstellung.
In diesem Beitrag erklären wir, was diese Begriffe im Sinne des Data Acts bedeuten, warum die korrekte Einordnung entscheidend ist und wie Sie sich praxisnah vorbereiten können.
Was ist ein “Vernetztes Produkt” gemäß Data Act?
Stellen Sie sich ein Gerät vor, das mehr kann als nur seine primäre Funktion zu erfüllen. Es sammelt Daten über seine eigene Leistung, seine Nutzung oder seine Umgebung und kann diese Daten übertragen – sei es auf einen Server, ein Smartphone oder einen PC. Genau das ist laut Art. 2 Nr. 5 des Data Acts ein “vernetztes Produkt”.
Die Kernmerkmale sind:
- Physisches Produkt: Kein rein digitaler Dienst.
- Aktive Datenerzeugung: Das Produkt erzeugt Daten über seine Leistung, Nutzung oder Umgebung (sog. Produktdaten).
- Technische Kommunikationsfähigkeit: Die Daten werden in auslesbarer Form übertragen (z. B. via WLAN, Bluetooth, Kabel).
- Abgrenzung: Produkte, deren Hauptfunktion allein in der Speicherung, Verarbeitung oder Übertragung von Daten im Auftrag Dritter liegt, sind ausgenommen (wie z.B. bei reinen Cloud-Servern).
Anschauliche Beispiele für vernetzte Produkte:
- Smart Home Thermostat: Misst Raumtemperatur und Heizverhalten, überträgt Daten an eine App zur Steuerung und Optimierung.
- Moderne Autos: Erfassen unzählige Datenpunkte – von Geschwindigkeit und Verbrauch über GPS-Position bis hin zum Zustand einzelner Komponenten – und können diese an den Hersteller oder Service-Apps senden.
- Industrielle Produktionsanlagen mit Predictive Maintenance: Sensoren überwachen Leistung, Verschleiß und Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur, Vibration) und senden die Daten zur vorausschauenden Wartung.
- Smarte Haushaltsgeräte: Ein Kühlschrank, der seinen Inhalt trackt oder eine Waschmaschine, die Nutzungsstatistiken an eine App sendet.
- Fitness-Tracker mit Datenübertragung: Misst Schritte, Herzfrequenz, Schlafzyklen und überträgt diese Daten an ein Smartphone oder eine Weboberfläche (Abgrenzung zum „verbundenen Dienst“ weiter unten).
Was ist ein “Verbundener Dienst” gemäß Data Act?
Nun wird es etwas komplexer. Ein “verbundener Dienst” (Art. 2 Nr. 6 Data Act) ist vereinfacht gesagt ein digitaler Dienst, der zum Zeitpunkt des Kaufs, der Miete oder des Leasings mit einem vernetzten Produkt eng verbunden ist und ohne den das Produkt wesentliche Funktionen nicht oder nur eingeschränkt erfüllen kann.
Die Kernmerkmale sind:
- Digitaler Dienst: Es handelt sich um eine Software- oder Service-Komponente (z.B. App).
- Kein elektronischer Kommunikationsdienst,
- Verbindung zum Produkt: Der Dienst ist beim Kauf, der Miete oder dem Leasing (oder auch nachträglich) mit dem vernetzten Produkt verknüpft.
- Wechselseitiger Datenaustausch: Produkt und Dienst tauschen Daten aus.
- Funktionale Abhängigkeit: Der Dienst ist notwendig für wesentliche Funktionen des Produkts. Hier liegt oft der Schwerpunkt bei Abgrenzungsfragen.
Das Fitness-Tracker Beispiel vertieft:
- Vernetztes Produkt: Der Fitness-Tracker selbst misst Schritte und Herzfrequenz. Diese Daten kann er ggf. auch direkt auf einem kleinen Display anzeigen.
- Verbundener Dienst (Wahrscheinlich JA): Die zugehörige Smartphone-App, die die Rohdaten des Trackers empfängt, analysiert, Trends aufzeigt, Schlafmuster detailliert auswertet und personalisierte Trainingstipps gibt. Denn ohne diese Analyse- und Auswertungsfunktionen, die über die reine Anzeige hinausgehen, wäre der Nutzen und die beworbene Funktionalität des Trackers für den Käufer möglicherweise stark eingeschränkt, so dass man von einer funktionalen Abhängigkeit für den eigentlichen Zweck sprechen kann.
- Verbundener Dienst (Wahrscheinlich NEIN): Die reine Anzeige der aktuellen Schrittzahl und Herzfrequenz auf dem Display des Trackers selbst. Dies ist eine inhärente Funktion des Geräts, kein separater Dienst. Auch eine einfache Synchronisation in eine Cloud zur reinen Datensicherung, ohne weitere Verarbeitung, fällt nicht zwingend darunter.
Weitere Beispiele für verbundene Dienste (und Abgrenzungen):
- Smart Home Sicherheitssystem:
- Vernetztes Produkt: Überwachungskamera mit Bewegungsmelder.
- Verbundener Dienst (Wahrscheinlich JA): Der Cloud-Dienst, der die Aufnahmen speichert, Alarme per Push-Nachricht sendet und den Live-Zugriff per App ermöglicht. Ohne diesen Dienst wäre die Kamera oft nur ein Sensor ohne wirklichen Sicherheitsnutzen.
- E-Bike mit “smarten” Features:
- Vernetztes Produkt: Das E-Bike mit Sensoren für Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Akkustand und GPS.
- Verbundener Dienst (Wahrscheinlich JA): Eine spezielle App des Herstellers, die zur Feinabstimmung der Motorunterstützung benötigt wird oder Diebstahlschutz-Funktionen über die App aktiviert/deaktiviert.
- Verbundener Dienst (Wahrscheinlich NEIN): Eine Standard-Fitness-App (z.B. Strava), die zwar die GPS-Daten des Bikes nutzen kann, aber für die Grundfunktion des E-Bikes (Fahren mit Motorunterstützung) nicht erforderlich ist.
- Moderne Fahrzeuge:
- Vernetztes Produkt: Auto mit diversen Sensoren.
- Verbundener Dienst (Wahrscheinlich JA): Das fest integrierte Navigationssystem, wenn es für seine Kernfunktion (aktuelle Karten, Verkehrsinfos) auf ständige Datenaktualisierungen über einen herstellereigenen Dienst angewiesen ist. Ebenso Over-the-Air-Updates, die für die Sicherheit oder wesentliche Fahrfunktionen nötig sind.
- Verbundener Dienst (Wahrscheinlich NEIN): Ein optionaler Musik-Streaming-Dienst im Infotainment-System.
Die Herausforderung: Abgrenzung der funktionalen Abhängigkeit
Wie die Beispiele zeigen, ist die Abgrenzung beim verbundenen Dienst nicht immer trennscharf. Die Frage der “funktionalen Abhängigkeit” des verbundenen Dienstes für eine “wesentliche Funktion” des Produkts erfordert stets eine wertende Betrachtung im Einzelfall. Für erste Klarheit dürften zunächst (unverbindliche) Leitlinien sowie Literatur- und Behördenansichten sorgen. Echte Rechtssicherheit wird dagegen erst die Rechtsprechung schaffen. Unser Rat: In Zweifelsfällen könnte es aus Compliance-Sicht sicherer sein, vorerst von einem verbundenen Dienst auszugehen und die Anforderungen zu prüfen.
Warum ist die Unterscheidung so wichtig? Pflichten aus dem Data Act!
Die korrekte Identifizierung ist kein Selbstzweck. Der Data Act knüpft an Vernetzte Produkte und Verbundene Dienste nämlich konkrete Pflichten, unter anderen:
- Datenzugangsrechte für Nutzer: Nutzer (sowohl Verbraucher als auch Unternehmen) erhalten das Recht, auf die von ihnen durch die Nutzung vernetzter Produkte erzeugten Daten zuzugreifen.
- Datenweitergabepflichten: Unter bestimmten Bedingungen müssen Sie als Hersteller oder Anbieter diese Daten auf Verlangen des Nutzers auch an Dritte weitergeben.
- Transparenzpflichten: Sie müssen Nutzer vorvertraglich darüber informieren, welche Daten generiert werden und wie darauf zugegriffen werden kann.
Handlungsbedarf: Was sollten Unternehmen jetzt tun?
- Inventarisierung: Analysieren Sie Ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Welche Ihrer Angebote könnten als “vernetztes Produkt” oder “verbundener Dienst” im Sinne des Data Acts gelten?
- Bewertung: Nutzen Sie strukturierte Hilfsmittel zur ersten Einschätzung. Beziehen Sie Ihre Fachabteilungen (Produktentwicklung, IT, Recht) mit ein.
- Fristen beachten: Beginnen Sie jetzt mit der Prüfung. Der Stichtag 12. September 2025 für erste Pflichten ist nicht weit entfernt. Teilweise gelten Übergangsfristen (Art. 50 DA). Die Umsetzung eventuell notwendiger technischer oder vertraglicher Anpassungen braucht Zeit.
- Rechtliche Prüfung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten oder zur Absicherung Ihrer Bewertung frühzeitig spezialisierten Rechtsrat hinzu.
Fazit
Der Data Act gestaltet die Spielregeln für die digitale Wirtschaft neu und betrifft potenziell jedes Unternehmen, das Produkte mit Datenanbindung oder darauf aufbauende datenbasierte Dienste anbietet. Die frühzeitige Auseinandersetzung mit den Begriffen “vernetztes Produkt” und “verbundener Dienst” ist essenziell, um Compliance-Risiken zu minimieren und die Chancen, die sich aus einem fairen Datenzugang ergeben, nutzen zu können.
Sie haben Fragen zur Einordnung Ihrer Produkte oder zu den Pflichten aus dem Data Act? Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Beratung.